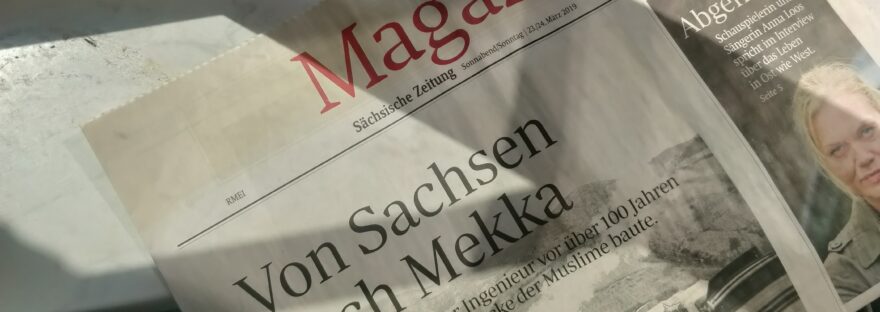„Seid mal kreativ“, hieß es. Anfang April 2019 hatte ich die große Ehre und durfte als erster Volontär meine Station im neuen Newsroom der SZ antreten. Das Herzstück des Hauses, in dem unser im November gestartetes Online-Portal „Sächsische.de“ produziert wird, flößte mir ordentlich Respekt ein. Immerhin laufen hier die Fäden zusammen, haben die großen Chefs ihre Büros, sitzen bei den täglichen Konferenzen vor vier riesigen Bildschirmen, die die nackten Zahlen zeigen. Trends, Klickzahlen, Abos. Ganz schön beeindruckend. Gleich am ersten Tag nach dem Mittagessen mit den neuen Kollegen fand ich mich mit einer Tasse Cappuccino im Foyer unseres Hauses wieder. Mir gegenüber: Fabian Deicke, Creative Director, begnadeter Marathon-Läufer und zuständig für jene Ideen, die die digitale Welt begeistern. Nach einem kurzen Kennenlernen ging es dann zur Sache: Ein Projekt sollte es werden. Fabian hatte sich viele Gedanken im Vorfeld gemacht. Seine Idee: Unseren Instagram-Feed gestalten, neue Follower gewinnen, die Community stärken. Am Ende meiner drei Monate soll ein handfester Workflow stehen, der unseren Fotografen, Volos und Online-Redakteuren die Arbeit in der Sphäre der einfangenden Bilder erleichtert.
Super Aufgabe, dachte ich mir und sagte freudig zu. Denn neben dem Schreiben knipse ich auch gerne, betreibe einen Instagram-Kanal und eine eigene Kunstfotografie-Homepage. Um Likes und Follower ging es mir daher bis dato eher weniger, viel mehr möchte ich abseits jeder digitalen Erwartungshaltung Bilder schießen, die meine Perspektive auf unsere Welt, unser Empfinden und unsere Gesellschaft zeigen. Bei einem Nachrichtenmedium wie Sächsische.de ist das natürlich anders. Unsere Fotografen bilden das ab, was in den sächsischen Regionen passiert, visualisieren tagesaktuelle Ereignisse, bringen mit klarer Bildsprache Ereignisse, Veränderungen sowie große und kleine Alltagsmomente direkt zum Leser. Eine Tageszeitung, ob sie nun digital oder Print umgesetzt wird, vertritt einen Informationsanspruch – und ist, besonders im Lokalen, den Lesern Klarheit und Stringenz schuldig.
Genau das macht Instagram zu einem eher schwierigen Kanal. Während Facebook, Twitter und Whatsapp jenen News-Charakter ziemlich gut spiegeln, setzt Instagram auf eine unpolitische Wohlfühlblase. Im Feed wird vorwiegend Schönes gezeigt. In den Kommentaren streiten sich keine rechten Trolle mit linken Aktivisten auf gehässige Art über das Urteilsvermögen schulstreikender Jugendlicher. Vergewaltigungen, Atomdeals und tödliche Autounfälle haben hier nichts zu suchen. Aber auch die kritische Auseinandersetzung mit weniger polarisierenden Themen wäre zu schwere Kost.
Gleichzeitig ist es relevant, auf allen Kanälen präsent zu sein. Wie kann ein Medium wie Sächsische.de das schaffen? Eine Gratwanderung, die mich in letzter Zeit manchen freien Abend kostete, an dem ich damit beschäftigt war, nach einer 8-Stunden-Social-Media-Schicht im Newsroom verschiedene Online-Ratgeber zu lesen, Profile anderer Zeitungen zu analysieren und mir die nächsten Schritte für die folgenden Meetings zu überlegen. Schnell wurde klar: Alles gar nicht so einfach wie gedacht. Doch glücklicherweise hatte Fabian bereits über mehrere Monate mit der Social-Media-Managerin unserer hauseigenen Werbeagentur ein Konzept ausgetüftelt, dass das Bedürfnis der Instagram-User nach Feel-Well-Community mit unserem Anspruch, online Storytelling zu betreiben, verbindet.
Die Idee: Eine klare Trennung von Feed und Story. Im Feed finden unsere Follower in regelmäßigen Abständen ästhetische, auf die Bildsprache des Netzwerks abgestimmte Landschafts- und Städtebilder aus allen Regionen Sachsens, die zum größten Teil von den Usern selbst stammen. Lila Wolken, direkte und lockere Ansprache, jeder kann partizipieren. In den Stories verlassen wir den statischen Bereich der virtuellen Galerie und setzen voll und ganz auf Dynamik. Hier spielt das Leben. Kurze Videoclips, Berichterstattung von Events, News, Storytelling, direkte Interaktion durch Umfragen, Einbindung von Usern in Real-Life-Projekte wie die Rewe-Team-Challenge in Dresden.
Das alles basiert auf der Erkenntnis, dass News im Instafeed einfach nicht funktionieren. Immer wenn die Infos zu konkret, die Geschichten komplex sind und dann noch frontal Gesichter abgebildet werden, scrollt der geneigte Instagrammer einfach weiter. Die Zahlen sprechen dabei Bände: Viele renommierte überregionale Zeitungen in Deutschland haben zwar eine Vielzahl an Followern, können mit ihren newsigen Geschichten im Feed jedoch kaum mit Likes punkten. Auch die Sächsische.de-Community konnte nur über die letzten sechs Monate anwachsen, weil diese Regel konsequent beachtet wurde. Unsere Nutzer wissen: Dieser Kanal ist nicht Pegida oder G-20-Krawalle, sondern Bastei, Neustadt und Meißner Dom im Sonnenuntergang. Trotzdem war uns allen klar: Ohne eine Verbindung zum Markenkern der SZ, nämlich gutem Journalismus, kommt auch der Feed auf Dauer nicht aus.
Fabians Wunsch war es, auch die hauseigenen Fotografen stärker einzubinden. Denn die sind schließlich jede Woche in der Region unterwegs und schießen viel mehr Bilder, als letztlich online und im Print erscheinen. Ich machte den Vorschlag, damit anzufangen, jeden Freitag ein SZ-internes Bild auf Instagram zu posten. Die Voraussetzung: Es musste in den Grundgedanken des Feeds passen. Um das zu erreichen, luden wir die Fotografen zu einem gemeinsamen Workshop ein. Hier und in weiteren persönlichen Gesprächen konnten wir die Kollegen überzeugen, beim Durchsehen ihrer Fotos immer auch auf eine mögliche Instagram-Tauglichkeit zu achten. Fällt Ihnen jetzt ein Exemplar auf, dass gut passen könnte, schicken Sie unserem Fotochef Veit Hengst in der Newsbar ganz einfach eine kurze formlose Mail mit der entsprechenden Datei. Die kommt dann in eine neu angelegte Instagram-Ordnerstruktur und wird unter „Vorschläge“ einsortiert.
Gleichzeitig beobachtet der Feedverantwortliche, in diesem Fall ich, über unser Bildarchiv immer wieder, welche neuen Fotos zu Artikeln eingestellt werden. So habe ich stets einen Überblick und kann entscheiden, welches Bild gut passen würde. Bei Bedarf lasse ich das Foto noch von der SZ-Bildstelle bearbeiten, so dass es letztlich einen passenden Look hat, oft ist das aber auch gar nicht notwendig. Zu guter Letzt noch ein ansprechender Text und fertig ist das Ganze.
Auch wenn es am Anfang einfach klingt, weil die sozialen Netzwerke so intuitiv funktionieren: Für einen optimalen Workflow musste ich viele Dinge beachten, an die ich am Anfang gar nicht gedacht hätte. Seien es Strukturen, Zuständigkeiten und Kapazitäten von Kollegen, aber auch zu wissen, was die User wollen und was sie schlicht ignorieren. Und natürlich die Frage, wie ich Geschichte und Bild ansprechend verbinden kann, um die Nutzer auch langfristig für unser Newsportal zu begeistern. Jedem, der zum ersten Mal mit einer ähnlichen Aufgabe betraut wird, kann ich nur raten, sich intensiv auszutauschen. Denn oft ist bereits viel Know-How vorhanden und muss nur noch gebündelt werden. So lassen sich Synergieeffekte prima nutzen. Und natürlich: Probieren, probieren, probieren. Keine Angst vorm Scheitern!
In nächster Zeit werde ich wohl viel damit beschäftigt sein, das was wir begonnen haben, weiter auszubauen. Warum nicht mehrere Tage mit Pressefotos auf Instagram, die Geschichten dazu kurz und knackig im Bildtext? Unser nächstes Ziel: 10.000 Follower. Bis dahin wartet noch viel Arbeit. Bis die Wolken wieder lila sind.